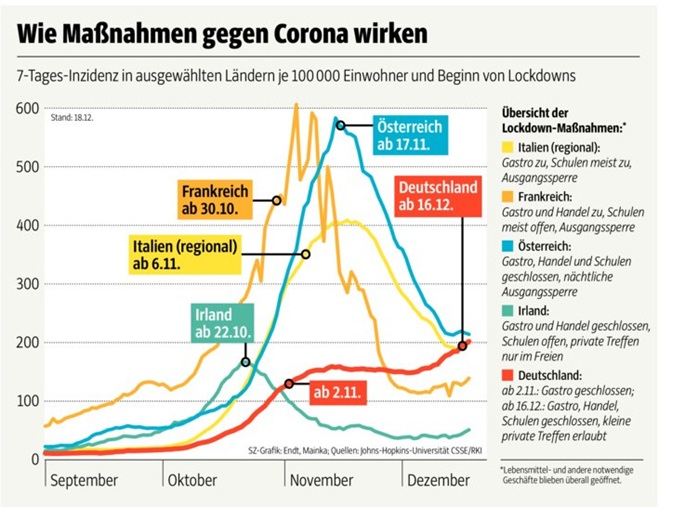Leitender Redakteur, Wissen Werner Bartens wurde 1966 in Göttingen geboren. Studium
der Medizin, Geschichte und Germanistik in Gießen, Freiburg, Montpellier
(F) und Washington D.C. (USA). Nach dem US-Staatsexamen Medizin (1992)
Forschungsjahr an den Nationalen Gesundheitsinstituten (NIH) in Bethesda
(USA). 1993 Staatsexamen Medizin in Freiburg und Promotion zum Dr. med.
mit einer Doktorarbeit über genetische Grundlagen des Herzinfarktes.
1995 Magisterexamen in Deutsch und Geschichte mit einer Abschlussarbeit
über Rassentheorien im 19. und 20. Jahrhundert. Bartens arbeitete zwei
Jahre als Arzt in der Inneren Medizin an den Unikliniken Freiburg und
Würzburg, anschließend Postdoktorand in der Arbeitsgruppe des
Nobelpreisträgers Georges Köhler am Max-Planck-Institut für
Immunbiologie in Freiburg. Seit 1997 Buchautor, Übersetzer, Ko-Autor
einer WDR-Seifenoper und tätig für SZ, Zeit, FAZ und taz. Von 2000 bis 2005 Redakteur im Reportage-Ressort der Badischen Zeitung und zuständig für Medizin; daneben Mitarbeit bei SZ, Zeit und taz. Seit 2005 ist Bartens Redakteur im Ressort Wissen der SZ,
seit 2008 Leitender Redakteur. Er hat mehr als 20 populäre Sachbücher
veröffentlicht, darunter etliche Bestseller wie "Das Lexikon der
Medizin-Irrtümer", "Körperglück", "Heillose Zustände", "Was Paare
zusammenhält" und "Wie Berührung hilft". Bartens ist zu Fragen der
Medizin und Gesundheitspolitik oft im Fernsehen zu Gast. Er wurde
vielfach mit Journalistenpreisen geehrt und 2009 als
"Wissenschaftsjournalist des Jahres" ausgezeichnet. Weitere Infos: www.werner-bartens.de
Dr. Christina Berndt, geboren 1969 in Emden, beschäftigt sich bei der Süddeutschen Zeitung
mit den Themenbereichen Medizin, Psychologie und Lebenswissenschaften.
1988 begann sie ihr Studium der Biochemie mit dem erklärten Ziel,
Wissenschaftsjournalistin zu werden. Mit einem Stipendium der
Studienstiftung des deutschen Volkes studierte sie in Hannover und an
der Universität Witten/Herdecke. Im Anschluss daran arbeitete sie
zunächst wissenschaftlich - während ihrer Doktorarbeit am Deutschen
Krebsforschungszentrum in Heidelberg, für die sie mit dem
Promotionspreis der Deutschen Gesellschaft für Immunologie ausgezeichnet
wurde. Schon während ihrer Promotion schrieb sie für die
Rhein-Neckar-Zeitung über Medizin und Forschung. Es folgten Praktika bei
der Deutschen Presseagentur, dem Spiegel, dem Süddeutschen Rundfunk, Bild der Wissenschaft und der Süddeutschen Zeitung,
zu deren Redaktion sie seit März 2000 gehört. Sie erhielt zahlreiche
Preise und Auszeichnungen: European Science Writers Award (2006),
Wächterpreis für die Enthüllung der Transplantationsskandale (2013),
Wissenschaftsjournalisten des Jahres 2013 (3. Platz),
Karl-Buchrucker-Preis (2018). Nominierungen für den Henri-Nannen-Preis
(2013), den Georg-von-Holtzbrinck-Preis für Wissenschaftsjournalismus
(2014) und den Deutschen Reporterpreis (2015 und 2017). Ihre Bücher
"Resilienz - Das Geheimnis der psychischen Widerstandskraft" und
"Zufriedenheit - Wie man sie erreicht und weshalb sie lohnender ist als
das flüchtige Glück" wurden Bestseller.
Felix Hütten ist Redakteur in der Wissensredaktion,
verantwortlich für das Wissen am Wochenende. Er hat in Dresden, Berlin
und Lyon Medizin und Politikwissenschaft studiert. Im Anschluss
Ausbildung an der Deutschen Journalistenschule (DJS) in München. Sein
Buch "Sterben lernen" ist 2019 im Hanser-Verlag erschienen.
Kathrin Zinkant, geboren 1974, begleitet das
Schicksal der Wissenschaft für die SZ in Berlin. Sucht nach
wissenschaftlicher Evidenz in der Bundespolitik, genauso wie nach Hand
und Fuß in den aktuellen Forschungsdebatten. Die Ethik ist immer mit
dabei. Hat Biochemie studiert und für die FAS, die Zeit, den Freitag und die taz gearbeitet. Ist naturgemäß ein Fan der Fernsehserie "Cosmos: A Personal Voyage".
Abstand halten
Am Anfang hieß es oft, man solle zwei Meter Abstand halten,
inzwischen verlangt das Abstandsgebot meist 1,5 Meter. Die Regelung soll
Tröpfcheninfektionen verhindern - also die Übertragung von Sars-CoV-2
durch kleine Tröpfchen, die Menschen beim Atmen, Husten, Sprechen und
Niesen absondern. Diese sinken im Umkreis von ein bis zwei Metern zum
größten Teil zu Boden. Außerhalb dieser Zone ist die Gefahr, sich über
die Tröpfcheninfektion anzustecken, daher gering. Nichtsdestotrotz ist
der geforderte Abstand willkürlich. Wie weit die ausgestoßenen Tröpfchen
fliegen, hängt von verschiedenen Faktoren ab - unter anderem von der
Raumtemperatur und der Luftfeuchtigkeit. Denn bei Hitze und Trockenheit
werden die Tröpfchen kleiner und sinken weniger leicht ab. Eine
Schutzzone von zwei Metern wäre somit sicherer, manche Tropfen fliegen
so weit, aber sie ist auch unpraktikabler.
Allerdings hilft Abstand halten nur gegen die größeren der
kleinen Tröpfchen, die Menschen absondern. Gegen die kleinsten
Tröpfchen, die Aerosole bilden, nützt der Abstand nichts. Denn die
winzigen Tröpfchen, die einen Durchmesser von weniger als fünf
Mikrometer haben und besonders häufig beim Schreien und Singen, aber
auch beim Atmen und Sprechen entstehen, bleiben lange in der Luft stehen
und können sich dort auch verteilen. Sie sind zu klein, um zu Boden zu
sinken. In geschlossenen Räumen reichern sie sich daher an. Auch
Aerosole gelten neben der klassischen Tröpfcheninfektion als ein
wesentlicher Ansteckungsweg bei Sars-CoV-2.
Handhygiene
Sars-CoV-2 kann tagelang auf manchen Oberflächen überleben.
Insofern besteht grundsätzlich die Möglichkeit, sich den Erreger
einzufangen, indem man damit benetzte Gegenstände anfasst. So banal und
altbacken diese Empfehlung auch daherkommen mag, regelmäßiges
Händewaschen gilt als eine anerkannte Grundregel gegen alle möglichen
Arten von Infektionen, auch gegen Corona. Denn Menschen greifen sich in
der Regel jeden Tag viele Male selbst ins Gesicht und können so Erreger
von den Händen auf jene Stellen übertragen, die für den Einfall der
Viren besonders empfänglich sind: die Schleimhäute von Mund, Nase und
Augen. Im öffentlichen Raum sollte man daher während der Pandemie
möglichst wenige Dinge berühren, und bei der Rückkehr nach Hause sollte
der erste Gang zum Waschbecken führen.
Alltagsmasken allgemein und im Freien
Noch Monate nach Beginn der Pandemie hieß es, das Tragen von
Mund-Nasen-Bedeckungen (MNB) durch Normalbürger könnte das Problem noch
vergrößern, da diese nicht sorgfältig mit Masken umgehen könnten; Ärzte
in Krankenhäusern würden dagegen intensiv im Gebrauch von Masken
geschult. Doch die Haltung hat sich gewandelt, seit Jena als erste
deutsche Stadt Anfang April gegen zahlreiche Widerstände ein Maskengebot
erließ. Alltagsmasken gelten mittlerweile neben Abstandsregeln und
Hygienemaßnahmen als einer der drei wesentlichen Pfeiler ("AHA") des
Infektionsschutzes, da sie Tröpfchen zurückhalten. Das sieht nun neben
den Gesundheitsbehörden der meisten europäischen Länder auch das
Robert-Koch-Institut (RKI) so, dem die wissenschaftliche Evidenz lange
nicht ausreichte. Masken schützen den Empfehlungen zufolge vor allem in
geschlossenen Räumen und dort, wo Abstandhalten schwer möglich ist.
Wissenschaftliche Studien untermauern mehr und mehr, dass Masken nicht
nur andere Menschen, sondern auch die Träger selbst schützen. So sank
die Rate der mit Sars-CoV-2 infizierten Ärzte und Pfleger in einem New
Yorker Krankenhaus deutlich, nachdem in dem Hospital eine Maskenpflicht für das gesamte Personal eingeführt wurde.
Das RKI empfiehlt inzwischen auch das Tragen von Masken in dicht
gedrängten Situationen im Freien, wenn dort in Menschenansammlungen der
Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. Denn wenn man von seinem
Gegenüber direkt mit feinen Tröpfchen bedacht wird, hilft der Zug an
frischer Luft auch nicht mehr.
Lüften
Neben "Superspreading" ist "Aerosole" das zweite Buzzwort der
Pandemie geworden. Die Erkenntnis, dass feinste, virusbeladene Tröpfchen
aus dem Atem sich über längere Zeit und mehrere Meter mit der Luft
bewegen und sich in geschlossenen Räumen schließlich gefährlich
anreichern können, hat zur Erweiterung der AHA-Regel geführt: Sie wurde
nun durch L wie Lüften ergänzt. Die Zufuhr von Frischluft kann dabei
durch technische Anlagen, im privaten Bereich aber auch ganz normal über
die Fenster erfolgen.
Bleibt die Frage, wie oft und lang ein Raum zu lüften ist. Das
hängt von der Zahl der Personen, klimatischen Faktoren wie Wind und
Temperatur, von der Größe des Zimmers und dessen baulicher
Beschaffenheit ab - und natürlich auch von der Zähigkeit der Menschen im
Raum. Nicht jeder ist für stündliches Stoßlüften bei einstelligen
Temperaturen gemacht. Dennoch ist klar: Wer regelmäßig lüftet, senkt das
Infektionsrisiko.
Corona-Warn-App
Seit dem 16. Juni 2020 gibt es in Deutschland die
Corona-Warn-App. Heruntergeladen haben sie bisher mehr als 18 Millionen
Menschen - 28 Millionen sind Umfragen zufolge dazu bereit. Und damit
beginnt das Problem. Bisher nutzt nicht mal ein Viertel der Bevölkerung
die freiwillige App. Der Anteil derer, die freiwillig eine Infektion
melden, dürfte noch geringer sein. Deswegen werden längst nicht alle
Neuinfektionen erfasst. Im Zuge der Testpannen wurde bekannt, dass auch
die Übermittlung der Testergebnisse oftmals nicht oder verspätet
erfolgte.
Die Zeitdauer von 15 Minuten für einen Risikokontakt ist
willkürlich; auch in fünf Minuten kann man sich anstecken. Allerdings
steigt das Risiko mit der Dauer des Kontakts. Jeder Grenzwert hat das
Problem der angemessenen Schwelle; auch wer Tempo 50 einhält, kann
Unfälle verursachen. Ein Baustein der Risikominimierung könnte die App
trotzdem sein. Der Nutzen ist aber schwer zu beurteilen, was auch daran
liegt, dass viele Datenschutzbedenken Berücksichtigung fanden. So werden
die Daten verschlüsselt und ausschließlich auf dem eigenen Smartphone
gespeichert. "Es gibt keine Daten, wie viele Menschen mithilfe der
Corona-Warn-App über eine mögliche Risikobegegnung informiert wurden, da
die App auf einem dezentralen Ansatz basiert", teilt das RKI mit. Eine
Arbeitsgruppe deutscher Forscher hatte der App im August - korrekt angewendet - anhand von Modellrechnungen eine große Wirksamkeit prophezeit. Im September hieß es von derselben Forschergruppe, dass "die Wirksamkeit noch zu beweisen" wäre.
Reisebeschränkungen
Schotten dicht, Grenzen zu, Züge im Bahnhof und Flugzeuge am
Boden? Mit den steigenden Fallzahlen werden nun in Politik und
Wissenschaft wieder vermehrt Reisebeschränkungen als Gegenmaßnahme
diskutiert. Zunächst ist es naheliegend, dass das Virus mit Menschen auf
Reisen geht. Wer also zu Hause bleibt, kann es nicht weitertragen. Auch
andersherum funktioniert die Regel: Wer viel unterwegs ist, in
Bahnhöfen, Flughäfen, Autobahnraststätten, trifft eher auf eine
infizierte Kontaktperson. Stillstand schützt. Was gegen das individuelle
Risiko einer Infektion hilft, lässt sich nicht unbedingt als sinnvolle
Maßnahme auf die Gesellschaft übertragen. Bereits im April zeigte eine
Simulation von Analysten um den Physiker Alessandro Vespignani, veröffentlicht im Fachblatt Science,
dass etwa Reiseverbote für die Einwohner Wuhans das Virus nur leicht
bremsen konnten. Es zirkulierte vor Ort bereits zu sehr. Zu einem
ähnlichen Fazit kommen Experten des renommierten Cochrane-Netzwerks in einer Auswertung
bestehender Studien zu dem Thema. Sie fanden lediglich leichte Hinweise
darauf, dass grenzüberschreitende Reisebeschränkungen die Zahl der
Neuinfektionen reduzieren. Deutlich effektiver erscheint, auch mit Blick
auf die wissenschaftliche Literatur zu dem Thema
aus Vor-Corona-Zeiten, etwa zur Ausbreitung von Grippeviren, der Kampf
gegen das Virus vor Ort. Insbesondere gilt es, lokale Herde zu vermeiden
und Infektionsketten schnell zu durchbrechen.
Sperrstunden
Kommen sich die Menschen weniger nahe, können sich weniger
anstecken. Das ist so banal wie richtig. Insofern sind Sperrstunden auf
den ersten Blick eine gute Idee. Entscheidend ist aber - wie so oft -
die Umsetzung. In den Ausgehvierteln Londons feierten Menschen dicht
gedrängt auf Straßen und in der U-Bahn, nachdem die Regierung Johnson
Ende September verordnet hatte, dass Pubs um 22 Uhr schließen. Manche
tranken aus derselben Flasche und umarmten sich - eine Einladung für
jedes Virus. Britische Virologen forderten daraufhin, Kneipen und
Restaurants zu schließen - oder die Öffnungszeiten zu verlängern, um das
Gedränge zu entzerren. In Salzburgs Innenstadt und andernorts in
Österreich führten vorgezogene Sperrstunden hingegen dazu, dass die
Straßen abends meist menschenleer waren.
Der Nutzen von Sperrstunden ist nicht belegt, denn es kommt
darauf an, wie andere Maßnahmen die Sperrstunden ergänzen. Kommt es
anschließend oder stattdessen nicht zu Treffen größerer Gruppen im
öffentlichen Raum oder privat, ist die Regel sinnvoll. Wird hingegen als
Ersatz für geschlossene Clubs und Kneipen zu Hause, im Park oder im Hof
gefeiert, steigt das Risiko für Neuinfektionen, da sich niemand für
Abstand, Masken und Hygiene verantwortlich fühlt.
Alkoholverbot
Alkohol gilt als gesellschaftliches Schmiermittel und Volksdroge
Nummer eins. Zur erwünschten Nebenwirkung von Alkohol gehört es, dass
zwischenmenschliche Hemmungen fallen und sich Abstände verringern. Nicht
gut in Zeiten der Pandemie. Insofern ist es naheliegend, dass Kommunen
in beliebten Stadtbezirken ein Alkoholverbot aussprechen. Doch damit
wird das Problem nur verlagert - deswegen ist ein Nutzen von
Alkoholverboten auch nicht wissenschaftlich erwiesen. Wer trinken will,
findet Ort und Gelegenheit dazu, auch in Gemeinschaft. Die Herde zieht
weiter und begünstigt Infektionen anderswo.
In etlichen Weltgegenden gibt es den Aberglauben, dass
Alkoholkonsum einer Ansteckung mit Sars-Cov-2 vorbeugt. Das Gegenteil
ist der Fall; regelmäßiger Alkoholkonsum schadet dem Immunsystem und
beeinträchtigt die Abwehrkräfte. Trotz erwiesener Gesundheitsgefahren
wäre ein komplettes Alkoholverbot in den meisten Ländern politisch nicht
durchzusetzen. Ein weiteres Problem: Jedes Gesundheitssystem würde vor
enormen Aufgaben stehen, wenn jene Alkoholkranken, die bisher nicht
behandelt werden, plötzlich auf Entzug kämen und mit akuten Symptomen in
Notaufnahmen und Kliniken müssten.
Quarantäne
Wer Kontakt mit einem Infizierten hatte, könnte sich angesteckt
haben - und wieder andere anstecken. Weil es bis zu fünf Tage dauert,
bis sich das Virus in den Schleimhäuten vermehrt hat und gegebenenfalls
durch einen Test nachgewiesen werden kann, müssen die Betreffenden sich
in häusliche Quarantäne begeben. Das heißt, man bleibt zu Hause und
meidet dort auch den Kontakt mit anderen Mitgliedern des Haushalts,
lässt sich also das Essen vor die Tür stellen und geht nur allein ins
Bad. Nach den ersten fünf Tagen kann dann getestet werden - oder aber,
die Person bleibt weiter in Quarantäne, auch wenn er oder sie nicht
krank wird. Infektionen können asymptomatisch verlaufen, dennoch sind
die Betreffenden in dieser Zeit mutmaßlich ansteckend für andere.
Wie lange die Quarantäne beizubehalten ist, wenn ein Test keine
Klarheit schafft oder positiv ausfällt, legt das zuständige
Gesundheitsamt fest. In der Regel sind insgesamt 14 Tage vorgesehen.
Neuere Erkenntnisse über den Infektionsverlauf legen allerdings nahe,
dass das Risiko einer Ansteckung durch asymptomatische Infizierte und
tatsächlich Erkrankte nach zehn Tagen bereits sehr stark gesunken ist
und eine weitere häusliche Isolation deshalb nicht unbedingt notwendig
ist. Gleichwohl müssen sich Menschen in Quarantäne uneingeschränkt an
die Vorschriften des Gesundheitsamts halten.
Kontaktbeschränkungen und Partyverbot
Das sogenannte Superspreading-Event ist zu einem Kernthema
dieser Pandemie geworden. Allzu häufig finden Massenansteckungen nämlich
auf Partys statt, auf denen sehr viele Menschen vor allem in
geschlossenen Räumen miteinander feiern. Fehlt es an Platz und
Frischluft, reichert sich das Virus in der Luft an, und Abstand
voneinander zu halten, ist beim Tanzen, lauter Musik und in dichtem
Gedränge eh schwierig. Das gilt für Karnevalsfeiern genau so wie für
Hochzeiten, Geburtstagspartys oder Clubevents. Solche Feiern werden
deshalb vielerorts nun untersagt oder zumindest auf eine maximale
Personenzahl beschränkt, die je nach Ort und Situation unterschiedlich
hoch angesetzt sein kann. In Bayern und Baden-Württemberg gilt ab einer
Sieben-Tage-Inzidenz von 35 Infektionen je 100 000 Einwohner eine
Begrenzung auf 50 Personen für private Feiern.
Welche Zahl wissenschaftlich sinnvoll ist, ist derzeit unklar.
Prinzipiell gilt gerade im Aufflammen der Pandemie jedoch, Kontakte ganz
allgemein zu reduzieren - durch einen kompletten Verzicht auf Partys,
aber auch durch einen eingeschränkten Umgang mit anderen Menschen im
Alltag. In der Regel ist festgelegt, dass sich höchstens Menschen aus
zwei verschiedenen Haushalten treffen sollen, empfohlen wird, den Kreis
von Kontaktpersonen klein und konstant zu halten.
Desinfektion
Sprühflaschen in Restaurants und Kneipen gehören zu den vielen
lästigen Neuerungen während der Pandemie. Ihr Sinn steht inzwischen
infrage. Denn mehr und mehr zeigt sich, dass Sars-CoV-2 vor allem durch
Tröpfchen und kaum über Oberflächen übertragen wird. "Eine routinemäßige
Flächendesinfektion in häuslichen und öffentlichen Bereichen wird in
der jetzigen Pandemie nicht empfohlen", schreibt das RKI. Vielmehr sei
eine angemessene Reinigung mit Seifenlauge "das Verfahren der Wahl".
Dem stimmt auch der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus
Reinhardt, zu. Die Erkenntnisse zu Übertragungswegen von Corona seien
eindeutig, sagte Reinhardt den Zeitungen der Neuen Berliner
Redaktionsgesellschaft. "Insofern ist die Desinfektion von Oberflächen,
die wir derzeit noch sehr intensiv betreiben, unsinnig und obsolet."
Auch das RKI räumt ein, dass eine Übertragung durch Oberflächen im
öffentlichen Bereich bisher nicht nachgewiesen worden sei. Abzuraten sei
in jedem Fall vom alleinigen Sprühen. Es ist nicht nur weniger wirksam
gegen Erreger als eine Wischdesinfektion, bei der Druck ausgeübt wird.
"Eine Sprühdesinfektion ist auch aus Arbeitsschutzgründen bedenklich, da
Desinfektionsmittel eingeatmet werden können."
Tests
Nur ein Test kann zeigen, ob sich jemand mit dem Coronavirus
angesteckt hat oder nicht. Tests sind daher die wichtigste Maßnahme, um
Infizierte zu finden, zu isolieren und zu verhindern, dass die
Betreffenden das Virus weitergeben. Neben der klassischen PCR, die im
Labor durchgeführt wird und je nach Situation nach einem oder mehreren
Tagen ein Ergebnis liefert, gibt es mittlerweile schnellere
Antigentests. Sie weisen Viruseiweiß nach und bieten binnen weniger als
einer Stunde ein Ergebnis. Hinzu kommen Schnelltests, die wie die PCR
das Erbgut des Virus nachweisen. Diese schnelleren Tests können eine
Infektion zwar nicht so sicher ausschließen wie die PCR. Sie liefern
jedoch einen Anhaltspunkt zur Infektiosität einer Person.
Bislang sind allerdings nur wenige solche Tests erhältlich - und
die Obergrenze der durchführbaren Tests wird weiter durch die PCR
festgelegt. Wird zu viel getestet, können Labors und Gesundheitsämter
dies nicht mehr bewältigen. Von ungezielten, massenhaft durchgeführten
Tests raten Experten deshalb inzwischen ab. Testen lassen sollten sich
Menschen mit einschlägigen Symptomen oder einem klar erhöhten
Infektionsrisiko - sowie Menschen, die besondere Gefahr laufen, schwer
zu erkranken und sogar zu sterben. Das betrifft vor allem ältere
Mitmenschen.
.